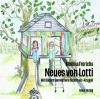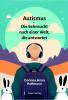23. Juni 1920: Abschaffung der Adelsprivilegien in Preußen. Die Adelstitel sind in Deutschland damit nur noch Namensbestandteile.
Adelstitel gehören seit Ende des Ersten Weltkriegs 1918 in Deutschland und Österreich der Vergangenheit an. Sie wurden in Deutschland 1919 durch die Weimarer Reichsverfassung (Artikel 109 der Verfassung des Deutschen Reichs in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 401-2, veröffentlichten bereinigten Fassung)[1] abgeschafft und durch Landesrecht in einen Bestandteil des Nachnamens überführt. Eine Verleihung ist nicht mehr möglich. Der EuGH hat jüngst entschieden, dass ein Mitgliedstaat es aus Erwägungen der öffentlichen Ordnung ablehnen darf, den einen Adelstitel enthaltenden Namen eines seiner Staatsangehörigen, wie er in einem anderen Mitgliedstaat erworben wurde, anzuerkennen. [2]
Deutschland [Bearbeiten]
Im kaiserlichen Deutschen Reich wurde der letzte Adelstitel am 12. November 1918 an Kurt von Kleefeld (1881–1934) verliehen, der jedoch keine Nachkommen hatte.
Im republikanischen Deutschen Reich wurden mit Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung von 1919 (Artikel 109) keine Adelstitel mehr verliehen; die bisherigen wurden zu (besonderen) Teilen des Namens. Alle Bürger waren vor dem Gesetz gleichgestellt, Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses waren ausgeschlossen.[1]
Am 23. Juni 1920 verabschiedete die preußische Landesversammlung das Preußische Gesetz über die Aufhebung der Standesvorrechte des Adels und die Auflösung des Hausvermögens. Nach diesem Adelsgesetz, das in ähnlicher Form auch von den anderen Ländern des Deutschen Reiches übernommen wurde, wurden die Primogeniturtitel, die auch bisher lediglich den Familienoberhäuptern und Herrschern zustanden, aufgehoben. Die von Familie zu Familie unterschiedlichen allgemeinen Titel, die die übrigen Familienmitglieder trugen, wurden in der Folge nicht mehr als Titel geführt, sondern als Teil des neuen Familiennamens definiert. Dies bedeutet, dass zum Beispiel die Titel Prinz oder Graf, die bisher allen Familienmitgliedern zustanden, als Namensbestandteile erhalten blieben, die Titel König, Großherzog usw., die nur den regierenden Personen (Herrschertitel) oder Familienoberhäuptern zustanden, entfielen ganz. Dies mündete in sehr unterschiedlichen Familiennamen. So tragen etwa die Nachkommen des ehemals königlichen Hauses Württemberg den Familiennamen „Herzog von Württemberg“ oder die Nachkommen des ehemaligen kurfürstlichen Hauses Hessen den Familiennamen „Prinz und Landgraf von Hessen“. Da der Titel Fürst nur in Ausnahmefällen ein Herrschertitel war, wird er aus Gründen der Traditionspflege heute noch vielfach geführt, obwohl er in der Regel kein Namensbestandteil mehr ist.
In einer Übergangsregelung war festgelegt, dass die Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Weimarer Reichsverfassung bereits einen Primogeniturtitel innehatten, diesen persönlich beibehalten durften, was insbesondere die ehemals regierenden Häuser betraf. Da die letzten Inhaber inzwischen verstorben sind, gibt es diese Bezeichnungen als Primogeniturtitel heute nicht mehr. Lediglich die von den Familien gewählten ehemaligen allgemeinen Adelstitel sind heute Teil des bürgerlich-rechtlichen Namens.
Nach einer Entscheidung des Reichsgerichts vom 10. März 1926 (RGZ 113, 107 ff.) werden die früheren Adelsbezeichnungen geschlechtsspezifisch abgewandelt.[3][4][5]
Darüber hinausgehende Rechtsfolgen hat ein Adelstitel heute nicht mehr. Allerdings findet er in manchen Gesellschaftskreisen und bei der Ermittlung des Ranges für das Protokoll immer noch Beachtung. Die von einigen Personen praktizierte Fortführung der historischen Adelstitel im gesellschaftlichen Leben hat insofern keine namensrechtliche Bedeutung, auch ein Anrecht auf die Anrede mit einem Prädikatstitel, wie zum Beispiel „Durchlaucht“, besteht nicht mehr.