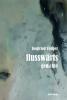Dankrede von Dr. Volker Issmer bei der Verleihung der Bürgermedaille der Stadt Osnabrück
Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, sehr verehrte Ratsmitglieder, liebe Familie und Freunde, liebe Gäste,
auf die ehrenden Worte, die Sie, Herr Oberbürgermeister, für mich gefunden haben, möchte ich gern antworten. Und dazu habe ich einen kurzen Text vorbereitet, den ich verlesen werde, damit meine Rede nicht zu lang gerät – ich kenne meine Schwäche.
Zunächst ein herzliches Dankeschön an alle, die ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass ich heute hier geehrt werde. Ich nenne den Rat, der mir die Medaille zuerkannt hat, meine Frau und die Söhne, die mich bei meiner langjährigen Forschungs- und Schreibarbeit mit Rat und Tat unterstützt haben, dem Korrekturlesen z. B., und dann all diejenigen, die mir sonst auf irgendeine Weise nach ihren Möglichkeiten geholfen haben.
Stellvertretend möchte ich hier zwei Personen nennen. Karin (Jabs-Kiesler), du hast meine Arbeit mit viel Engagement und Sympathie begleitet. Trotz deiner zahlreichen Verpflichtungen als Bürgermeisterin warst du bereit, in die inzwischen aus drei Bänden bestehende Kurzgeschichten-Reihe „Fremde Zeit – Unsere Zeit“, erschienen im Geest-Verlag, schriftlich einzuführen sowie mehrere Buchpremieren zu eröffnen, was Du mit großer Sorgfalt und gestützt auf Dein profundes historisch-politisches Wissen ausgeführt hast. Es muss Dich auch allerhand Arbeit und Energie gekostet haben – ganz herzlichen Dank.
Dieter Przygode, Bramscher Bürger und Mitarbeiter in der Verwaltung unserer Stadt, forscht wie ich über regionale NS-Zusammenhänge, wobei er sich vor allem auf den Raum Bramsche konzentriert. Kürzlich hat er ein Buch mit dem Titel „Von Bramsche nach Argentinien“ herausgegeben, in dem er das Schicksal der jüdischen Familie Voss beschreibt, die 1937 ihre Heimatstadt verlassen musste, um der Verfolgung durch die Nazis zu entkommen. Dieter ist ein guter Freund, der mir seit Jahren mit Rat und Tat bei meiner Arbeit zur Seite steht. Er ist z. Z. mit einer Bramscher Delegation in Israel zu Besuch in der Partnergemeinde und kann deshalb leider nicht an dieser Ehrung teilnehmen. Mit dem, was er tut, leistet er wirklich Versöhnungsarbeit und verdiente dafür öffentliche Anerkennung – vielleicht fallen meine Worte ja in Bramsche und/oder beim Landkreis auf fruchtbaren Boden.
Die Medien in der Region (NOZ, ON, „Abseits!?“, blick-punkt GMH, osradio) haben immer wieder über meine Arbeit berichtet und so für Öffentlichkeit gesorgt. Das sei hier mit Dank vermerkt. Koert Braches, Städtebotschafter für Haarlem, war Mitstreiter der ersten Stunde.
Ich könnte jetzt noch manch’ anderen unter den hier Versammelten nennen, und darüber hinaus die vielen, die mir vertraut und Interviews gegeben haben, darunter manch ehemaliger Häftling des sog. „Arbeitserziehungslager Ohrbeck“. Aber dazu reicht die Zeit leider nicht. Lassen Sie mich allerdings noch auf eine Erkenntnis eingehen, die ich bei meiner Arbeit gewonnen habe, für die ich heute geehrt werde.
Über die lokalen und regionalen NS-Zusammenhänge ist inzwischen allerhand an Ergebnissen zusammengetragen und publiziert worden – ich nenne hier nur den Sammelband „Topografie des Terrors. Nationalsozialismus in Osnabrück“, herausgegeben von Dr. Thorsten Heese und unterstützt von der Stadt und mehreren Einrichtungen. Worüber ich mir noch weitere Forschungen wünschte, wäre der Widerstand gegen die Nazis. Manches ist bekannt und aufgearbeitet, vieles aber noch immer ungeklärt bzw. unbekannt. So bin ich z. B. erst im vergangenen Jahr auf das Schicksal von Hugo Kones gestoßen, eines Sozialdemokraten und Lehrers, der 1933 „wegen sozialistischer Umtriebe“ aus dem Dienst entlassen und ins KZ Esterwegen eingeliefert wurde. Später lebte er mit seiner Frau unter elenden Umständen in unserer Stadt, weil man ihn nicht zurück in den Schuldienst lassen wollte.
Bernd Schopmeyer, Zentrums-Angehöriger und Mitarbeiter in der Verwaltung des Bistums, wurde kurz nach Kriegsende im Bürgerpark mutmaßlich von Nazis ermordet, wohl weil er zu viel über sie wusste. Sein Andenken wird durchaus in Ehren gehalten, aber die Umstände seines Todes sind bis heute nicht geklärt. Nach Luise Lütkehoff, die einen Wächter daran hinderte, auf einen Ohrbeck-Häftling einzuschlagen, ist inzwischen eine Straße in Eversburg benannt. Aber wer kennt die nach hunderten oder sogar tausenden zählenden Fälle, in denen Menschen aus der Region wegen fehlender Anpassung an das Regime oder sogar Widerstandshandlungen „polizeiauffällig“ geworden sind und Eingang in die hiesige Gestapo-Kartei gefunden haben? Die Frau, die entgegen dem Verbot durch den „Polenerlass“ den bei ihr tätigen polnischen Zwangsarbeiter mit in die Messe nahm? Oder die Frauen und Männer, die in verbotenen Liebesbeziehungen standen oder eine „privilegierte Mischehe“ führten, wie die zynische Bezeichnung lautete, und sich nicht vom jüdischen Partner scheiden ließen, trotz aller Pressionen durch das Regime? Den „kleinen“ Widerstand der „kleinen“ Leute aufzuarbeiten, die in Wahrheit so groß gehandelt haben, und ihrer zu gedenken bleibt eine Aufgabe, die weiterhin besteht. Welche Wichtigkeit dieser Aufgabe gerade in einer Zeit zukommt, in der autoritäre Denk- und Verhaltensmuster wieder zunehmen und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gefährden, brauche ich wohl nicht weiter auszuführen.
Von meiner Herkunft her bin ich Schlesier, 1946 mit der Familie aus der Heimat vertrieben, als Folge des von Hitler und der NS-Diktatur entfesselten Zweiten Weltkriegs. Es hat lange gedauert, bis ich hier wirklich „angekommen bin“. Spätestens heute Abend kann ich sagen, dass dieser Prozess seinen Abschluss gefunden hat, und dafür bin ich dankbar. Ich freue mich auch, dass ich zusammen mit einer Frau geehrt werde, die sich für eine so segensreiche Einrichtung engagiert, wie sie die Hospize darstellen. Ich gratuliere ihr ganz herzlich und bedanke mich bei Ihnen für’s Zuhören.