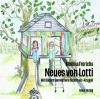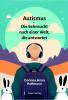Die bemerkenswerte Einführungsrede von Bürgermeisterin Karin Jabs-Kiesler zum Buch von Volker Issmer: Fremde Zeit - Unsere Zeit - Band II' im Erich-Maria-Remarque-Zentrum in Osnabrück vom 8.11.2012
Nachfolgend die bemerkenswerte Einführungsrede von Bürgermeister Karin Jabs-Kiesler zur Buchpremiere von Volker Issmer 'Fremde Zeit - Unsere Zeit Band 2' am 8. November 2012 im Erich-Maria-Remarque-Zentrum Osnabrück
Fremde Zeit - Unsere Zeit, Band II
Zur Einführung am 8. November 2012 im Remarquezentrum
Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Dr. Schneider! Frau Le Coutre-Bick! Herr Steggewentz! Lieber Volker Issmer!
Was für ein besonderer Tag! Was für ein Ort! Trotz der Thematik, um die es heute bei dieser Lesung gehen wird, ist es ein Anlass zur Freude, dass der zweite Band der Erzählungen Volker Issmers hier vorgestellt wird - im Erich-Maria-Remarque-Friedensszentrum am Markt. Und dazu eingeladen haben zudem das Literaturbüro Westniedersachsen sowie die Remarquegesellschaft, womit wieder einmal die Bedeutung ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagements in unserer Stadt unter Beweis gestellt wird. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und damit sowohl dem Thema wie dem unermüdlichen Kämpfer für Aufklärung und gegen das Verdrängen, Volker Issmer, Ehre zu erweisen.
Das mag manch einem etwas hochtrabend formuliert Vorkommen, aber angesichts zunehmender rechstextremistischer Tendenzen in unserem Land kann die Bedeutung des vorliegenden zweiten Bandes von „Fremde Zeit - Unsere Zeit“ gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das ist jedenfalls meine feste Überzeugung. Vor drei Tagen wurde in der BBS Pottgraben eine Wanderausstellung des Verfassungsschutzes eröffnet. Sie ist zwar umstritten wegen der fünf Tafeln, die sich auch mit dem Linksextremismus befassen. Sie gibt meiner Ansicht nach aber auf dreißig Tafeln doch einen umfassenden Überblick über die aktuellen Formen des Rechtsextremismus, darunter insbesondere Beispiele entsprechender Musik. Die Liedtexte und die Kurzprofile der Bands jagen einem Schauer des Entsetzens über den Rücken. Wie sehr gerade die Musik auf emotionale Wirkung zielt und auf Jugendliche verführerisch wirkt, braucht nicht extra betont zu werden. Festzuhalten ist allerdings, dass nach den Vorgängen um die Zwickauer Zelle und die sog. NSU-Kreise es mehr denn je erforderlich ist, vor allem in den Schulen über rechte Anwerbemethoden zu informieren. Dass bei der jetzigen Ausstellung in der BBS Pottgraben das Versagen der Behörden des Verfassungsschutzes nicht angesprochen wird, ist allerdings ein Ärgernis.
Mit Blick auf die gesamte Problematik besteht in jedem Fall aller Anlass, Volker Issmer für seine einfühlsamen Kurzgeschichten zu danken, Geschichten, die uns wie beim ersten Band nicht gleichgültig lassen und die - das möchte ich ausdrücklich gleich zu Beginn betonen - in jeder Weise spannend zu lesen sind und eine Fülle ganz unterschiedlicher Ebenen und Bereiche beleuchten. Das betrifft sowohl die zeitliche Ebene wie die Perspektive, in der Regel die aus Sicht der Opfer. Es sind exakt zwanzig Geschichten, die sowohl in der Gegenwart wie in der unmittelbaren Nachkriegszeit als auch noch während des Krieges spielen. Ich habe sie zweimal aufmerksam gelesen und dabei festzustellen versucht, welche der Geschichten mich denn am meisten berührt oder bewegt hat. Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil jede Geschichte ihre Besonderheit hat und auch Bewunderung auslöst ob der Geschicklichkeit, mit der der Autor die verschiedenen Themen zu vermitteln versucht.
So personifiziert er in der Geschichte „Der Schrank“ einen Baum und lässt ihn seine Lebensgeschichte erzählen, die die Ereignisse um die Beschlagnahme und den Verkauf jüdischen Besitzes und vieles mehr umfasst. Oder er verdeutlicht in einem Gespräch zwischen Lehrer und türkischem Schüler, dass im Augustaschacht auf dem Weg über die Fremdenlegion auch ein Mann türkischer Herkunft als „Schlächter“ fungiert habe ebenso wie ein Ukrainer namens Alexander. Eine andere Geschichte mit dem Titel „Italien Wiedersehen“ ist mit Blick auf den gerade erschienenen Film „Die Geige aus Cervarolo“ höchst aktuell. Der Sohn fährt mit seinem alten gebrechlichen Vater auf dessen Wunsch in ein italiensiches Dorf.
Auf dem Weg dorthin lenkt der Vater das Gespräch auf den Partisanenkrieg, in dem das Kriegsrecht keine Gültigkeit habe. Im Dorf wird er von einer alten Frau als „Mörder“ beschimpft. Vielleicht ist ihnen erinnerlich, dass vor kurzem ein 94-jähriger Angeklagter aus Osnabrück bei einem Prozess in Verona freigesprochen wurde, weil ihm die Gräueltaten, um die es in dieser Geschichte letztlich geht, nicht nachgewiesen werden konnten. Eine andere Erzählung berichtet von einem ehemaligen Ratsgymnasiasten, der mit 25 Jahren in Frankreich gefallen ist und über dessen Tod es in einem „Feldpostbrief an unsere ehemaligen Schüler“ vom Oktober 1942 heißt: „In seligem Glück vorwärtsstürmenden Sieges ist er dahingegangen.“ Die Darstellung weckt in mir unmittelbar die Erinnerung an die Festschrift zum 400-jährigen Bestehen dieses Osnabrücker Traditionsgymnasiums im Jahre 1995 und an die Aufregung über den Herausgeber der Schrift, damals Fachleiter für das Fach Deutsch am Studienseminar, dessen umfangreicher Artikel darin über das Ratsgymnasium und seine Gefallenen seit 1918 für erheblichen Wirbel sorgte. In der Presse war eine längere Rezension dieser Festschrift sogar überschrieben mit den Worten „Schulgeschichten und ein Unbelehrbarer“. Und Rolf Wemstedt, damals Kultusminister in Niedersachsen, unterstreicht in seiner Festrede, dass Thermopylai und Langemarck nicht einfach kurzgeschlossen werden können und dieser Aufsatz in seinen Wertungen indifferent und unreflektiert sei, denn „wer über die Toten der Weltkriege spricht, kann dies nach all dem, was wir heute aus der Zeit des Nationalsozialismus wissen, nicht mehr unschuldig tun.“ Das ist wohl wahr.
Dennoch habe ich den umstrittenen Aufsatz jetzt bei erneuter Lektüre weniger schlimm empfunden als zum Beispiel eine kritische Betrachtung unter der Überschrift „Hellas statt Holocaust“ in der ZEIT im Sommer 2011. Darin setzt sich der namhafte Historiker Heinrich August Winkler mit dem Geschichtsbild des Rostocker Althistorikers Egon Flaig auseinander, das einer Wiederbelebung des westdeutschen Geschichtsbildes der fünfziger Jahre entspreche. Der Artikel in der ZEIT ist im Zusammenhang mit der 25. Wiederkehr des Historikerstreites zu sehen, in dessen Verlauf Jürgen Habermas und eine ganze Reihe bedeutender Historiker, u.a. Hans Mommsen und Hans-Ulrich Wehler, die These Ernst Noltes bekämpften, wonach der Archipel Gulag ursprünglicher als Auschwitz gewesen sei und die Verbrechen Stalins denen Hitlers in nichts nachstünden. Es handelte sich insgesamt um eine Relativierung des Holocaust. Ich wage nicht zu behaupten, dass wir über eine solche Sichtweise mittlerweile hinweg seien. Aber auf Grund fortschreitender intensiver historischer Forschung, die nach der Wende bisher verschlossene Quellen sichten konnte, wird hoffentlich mehr und mehr Bürgern unseres Landes bewusst, dass es sich beim Holocaust um ein Menschheitsverbrechen handelt, verübt in systematischer industrieller Massenvemichtung durch ein Land, das sich kulturell zum Westen gehörig empfand - allerdings mit Einschränkungen, wie Winkler klar begründet.
Er betont nämlich, dass sich die traditionellen Eliten Deutschlands in einem wesentlichen Punkt von den Nationen des transatlantischen Westens unterschieden, darin nämlich, dass es sich die Ideen der Amerikanischen und Französischen Revolution allenfalls teilweise zu eigen gemacht habe. „Die unveräußerlichen Menschenrechte, die Prinzipien der Volkssouveränität und der repräsentativen Demokratie bildeten keinen Teil der politischen Kultur des Kaiserreiches. Gehorsam gegenüber dem Staat ... stand beim Bürgertum des Bismarckreiches höher im Kurs als der Gedanke politischer Verantwortung für das Gemeinwesen.“ Und er unterstreicht weiter, dass die deutschen Kriegsideologen den „Ideen von 1789“ die „Ideen von 1914“ gegenübergestellt und damit den deutschen Kultur-, Macht- und Obrigkeitsstaat als überlegene Antwort auf die universellen Werte der westlichen Demokratien präsentiert hätten. Daraus ergab sich fast von selbst, dass nach 1918 die parlamentarische Demokratie von Weimar einem großen Teil der staatstragenden Eliten als Staatsform der Sieger und darum als „undeutsch“ galt - „eine Deutung, der sich Hitler
anschloss“ wie Winkler sagt und er fügt hinzu: „Der Nationalsozialismus war die extremste Steigerung des antiwestlichen Ressentiments der Deutschen.“
Besonders zwei Geschichten in der vorliegenden Textsammlung haben mich veranlasst, etwas eingehender auf diesen ZEIT-Artikel einzugehen. Die eine mit dem Titel „Die Mappe oder Yad Vashem“ beschreibt, wie die Tochter nach dem Tod des Vaters in Jerusalem in der Gedenkstätte Yad Vashem ein großes Foto des Verstorbenen entdeckt. Männer in SS-Uniform stehen in der Nähe einer Grube, an deren Rand eine Gruppe von Frauen dabei ist, sich zu entkleiden. Sie will die Mappe, die ihr Vater hinterlassen hat, jetzt endlich lesen, um zu wissen, wer ihr Vater wirklich war. Als Kind hat der sie nämlich zu Treffen der HIAG mitgeschleppt, einem Verein ehemaliger SS-Angehöriger, und sie außerdem veranlasst, „den ganzen Mist eines rechtsradikalen Verlags“ zu lesen, für den der Vater damals gearbeitet hat. Kritisch hinterfragt hat sie die Kriegserlebnisse ihres Vaters offenbar nicht, wie so viele ihrer Generation. Das Schweigen in den Familien ist ja hinlänglich bekannt. Und auch darum sind die Geschichten, so wie Volker Issmer sie erzählt, so wertvoll.
Erst jetzt erfolgt durch die Enkelgeneration ein unverkrampfterer Umgang mit den Quellen, wird deutlicher erkannt, dass die Großvätergeneration erheblich mehr gesehen und gewusst hat, als sie später einzugestehen bereit war. Der 1982 geborene junge Historiker Moritz Pfeiffer, heute tätig im Dokumentationszentrum der Wewelsburg, hat dies mit seinem jüngst erschienenen Buch „Mein Großvater im Krieg 1939-1945“ wunderbar verdeutlicht. So schreibt er zum Beispiel: „Zahlreiche Einstellungen, die später den Nationalsozialismus stützten, waren auch in der Familie meines Großvaters vorhanden“, so die Empörung über den Schandfrieden oder das Diktat von Versailles, die Leugnung der Kriegsschuld am Ersten Weltkrieg. Heinrich August Winkler spricht diese Sichtweise in dem bereits erwähnten ZEIT- Artikel ebenfalls an und kritisiert bei Egon Flaig die Rückkehr in die Welt der deutschnationalen Geschichtsapologie, zu deren Versatzstücken es bis in die 80-er Jahre gehörte, dass Hitlers Machtübernahme ein „Betriebsunfall“ war, dass die Wehrmacht bis zum bitteren Ende ebenso anständig geblieben sei wie die überwältigende Mehrheit der Deutschen und dass, soweit es auf deutscher Seite Verbrechen gab, diese ausschließlich auf das Konto von Hitler, Himmler und ihren Spießgesellen ging.
Ich erinnere an die berühmte Wehrmachtsausstellung, an die Empörung, die darüber durch unser Land ging, weil sie ja Dinge aufdeckte, die den allermeisten bis dahin durch Schweigen oder Leugnen, Vertuschen oder Verharmlosen nicht bekannt waren. Eine der letzten Geschichten offenbart überdeutlich, wie sehr sich die führenden Militärs die NS-Ideologie bzw. die NS-Propaganda zu eigen gemacht haben, wie unfähig sie geworden waren, der Realität ins Gesicht zu sehen - selbst im März 1945. Diese „Abseits-Geschichte“ berichtet von dem Major Kurt Rheindorf, dessen Nachlass sich im Bundesarchiv befindet. Ein Brief an seine Frau wird in voller Länge wiedergegeben. Er ist voller Schilderungen über die Vertiertheit der Rotarmisten und äußert die Überzeugung, dass NS-Deutschland die militärische Niederlage noch abwenden könne. Der Autor fragt, ob er sein Mäntelchen nur nach dem Wind gehängt habe, denn nach dem Krieg habe er als ausgewiesener Gegner des NS-Regimes gegolten. Fragen über Fragen drängen sich auf, die vielleicht zu einer neuen Deutung dieser fragwürdigen Persönlichkeit der Zeitgeschichte führen.
Erlauben Sie mir noch, auf eine ganz andere Geschichte einzugehen. Sie trägt den Titel „Der Besuch“. Darin wird geschildert, wie eine Vertreterin der Partei, wohl aus der NS- Frauenschaft, eine Hausfrau aus der Arbeiterschicht überraschend aufsucht, um deren Haushaltsführung zu kontrollieren. Die normalerweise resolute Frau, Mutter von vier Kindern, ist gerade in der Waschküche und hat am Morgen noch keine Zeit gefunden, die
Wohnung aufzuräumen. Es geht um den Antrag der Familie zu siedeln, d.h. mit staatlicher Unterstützung ein Haus zu bauen. Diese Geschichte empört unmittelbar, weil sie den Zustand völliger Unfreiheit und Abhängigkeit bis in den privatesten Bereich hinein so hautnah schildert. Es ist eine Form der Kontrolle und der Bespitzelung, die wir uns heute kaum vorstellen können und die ja auch im nachbarschaftlichen Umgang miteinander eine große Rolle gespielt haben muss. Mir fiel bei der Lektüre plötzlich jene Szene am Neumarkt ein, die mir 1967 widerfuhr, wenige Monate nach unserem Umzug aus Hannover. Ich stand mit unserer zweijährigen Tochter an der Bushaltestelle und hörte auf einmal eine vorwurfsvolle Stimme neben mir: „Die Schuhe der Kleinen müssten aber mal wieder geputzt werden“.
Ich weiß nicht mehr, wie ich damals reagiert habe. Heute frage ich mich allerdings, ob sich in solcher Art der Einmischung nicht Spätfolgen der NS-Diktatur gezeigt haben. Es war ja noch vor der Bewegung der 68-er, der wir viel zu verdanken haben. Wieviel, das hat Jürgen Habermas 1986 nach dem vorhin angesprochenen Historikerstreit zum Ausdruck gebracht, indem er unterstreicht: „Die vorbehaltlose Öffnung der Bundesrepublik gegenüber der politischen Kultur des Westens ist die intellektuelle Leistung unserer Nachkriegszeit, auf die gerade meine Generation stolz sein könnte“.
Heute haben wir es im wiedervereingten Deutschland mit einer veränderten Situation zu tun. Zunehmend gilt es zu fragen, in welchem Umfang und in welcher Weise es im westlichen Teil der Bundesrepublik tatsächlich, wenn auch erst spät, gelungen ist, durch die Möglichkeit des Vergleichs mit dem transatlantischen Westen, durch Reisen und Aufklärung bis hin zur Rede Richard von Weizsäckers am 8. Mai 1985 sich unserer belasteten Vergangenheit wirklich zu stellen.
Fest steht wohl, dass wir uns nicht zurücklehnen und meinen können, wir hätten genug getan. Das, was geschehen ist, wird uns noch lange nicht loslassen. Längst wissen wir, dass dies auch für den ganz privaten Bereich gilt, für jeden Bauernhof, auf dem Zwangsarbeiter tätig waren, für alle Selbstschutztruppen, die in den Wochen nach Kriegsende ihr Jagdgewehr nicht abgaben und auf ihre Weise für „Gerechtigkeit“ sorgten, für all die Briefe, die damals geschrieben wurden und deren Inhalt uns heute entsetzt feststellen lässt, wie tief die NS- Propaganda die Geister infiltriert hat.
Ich danke Volker Issmer in Ihrer aller Namen, dass er mit dieser Textsammlung erneut dafür gesorgt hat, sich der Erinnnerung zu stellen, so schmerzhaft sie in vielerlei Hinsicht auch sein mag. Danke für Ihre Geduld.
Karin Jabs-Kiesler