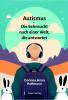'Elese Ury 'Nesthäkchen und der Weltkrieg' nach ersten Berichten in Radio und Presse gut nachgefragt
Der unten stehende, gestern erschiienene Bericht Bericht über die Neuausgabe von Else Urys 'Nesthäkchen und der Weltkrieg' und das RadioInterview auf WDR 3 von Marianne Brentzel sorgten gestern für eine Vielzahl von Bestellungen gerade aus dem norddeutschen Raum.
Erschütterung der heilen Nesthäkchen-Welt
http://www.nwzonline.de/kultur/erschuetterung-einer-heilen-welt-erschuetterung-der-heilen-nesthaekchen-welt_a_15,0,1687762168.html
Geest-Verlag in Vechta legt besonderen „Nesthäkchen“-Band wieder auf
Der Band 4 der Reihe wurde seit seinem Erscheinen 1922 nicht wieder verlegt. Else Ury thematisiert darin den Ersten Weltkrieg. 1943 wurde die Autorin in Auschwitz ermordet.

Bild: Geest-Verlag
Vechta/BerlinWas dem Enkel sein „Harry Potter“ ist, war der Oma ihr „Nesthäkchen“: Eine Bestseller-Reihe, die dem pubertierenden Publikum über Jahre hinweg Lesestoff und Identifikationsmöglichkeit bot. Vor 1945 nahmen 1,5 Millionen dieses Angebot an, nach 1945 weitere sechs Millionen, Tendenz steigend.
 Buchumschlag des neuen Bandes
Buchumschlag des neuen Bandes Abschied vom Vater, Illustration von R. Sedlacek
Abschied vom Vater, Illustration von R. SedlacekZum Buch
Das Buch „ Nesthäkchen und der Weltkrieg“ von Else Ury ist in einer Neuauflage mit einem Vorwort von Marianne Brentzel im Geest-Verlag in Vechta erschienen (228 Seiten, 12,50 Euro).
Else Ury wurde am 1. November 1877 in Berlin geboren. Die jüdische Autorin starb am 13. Januar 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Ury war vor allem Kinderbuchautorin. Ihre bekannteste Figur ist die blonde Arzttochter Annemarie Braun, deren Leben sie in den insgesamt zehn Bänden der Reihe „Nesthäkchen“ erzählt.
Hinzu kommen zwölf Millionen Zuschauer allein der Erstausstrahlung einer Verfilmung im ZDF und die Käufer der DVDs. Nun ist ein neues „Nesthäkchen“-Buch auf dem Markt: „Nesthäkchen und der Weltkrieg“, erschienen im Geest-Verlag Vechta mit einem Vorwort von Marianne Brentzel.
Stricken für den Sieg
„Neu“ bedarf der Erläuterung. Schließlich erschien das Buch erstmals 1922 als Band 4 der populären Reihe. Andererseits wurde es seither nicht wieder verlegt, ja sogar 1945 von den Alliierten als kriegsverherrlichend verboten.
Während alle übrigen Bände, sprachlich geglättet und der Zeit angepasst, wieder und wieder erschienen, blieb Band 4 dem Bewusstsein der Deutschen entzogen. Nun, 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs, von dem es redet, erlebt das Buch eine eng dem Original verhaftete Premiere. Unter Verzicht auf sprachliche Glättung und moderne Illustration ist der Text wie die ursprüngliche Fassung in Frakturschrift gesetzt und versehen mit Faksimiles der Originalillustrationen, farbigen Aquarellen, die die oft lapidare Leichtigkeit des Textes sicher treffen.
Der verhandelt das Einbrechen des Kriegs in die heile Welt der Arztfamilie Dr. Braun. Tochter Annemarie, Nesthäkchen genannt, kehrt von einer Inselverschickung zurück. Zuhause hat Großmutter das Zepter übernommen. Mutter, auf Verwandtenbesuch in England vom Krieg überrascht, ist dort festgesetzt worden. Vater, der Oberstabsarzt, tut Dienst am Schützengraben.
In dieser Situation lernt (so eine Kapitelüberschrift) „Nesthäkchen Opfer bringen“. Ihre Schule dient als Lazarett: Sie nimmt lange Wege in Kauf. Es gibt keine Butter: Sie steht stundenlang an. Sie hasst Strickarbeiten: Für den Sieg strickt sie tagelang Strümpfe. Noch dazu tut das intelligente Kind sich hervor als patriotische Eifererin, die Strafgeld einsammelt bei Benutzung nichtdeutscher Begriffe, und sich als Rädelsführerin betätigt, als ein polnisch-sprachiges Mädchen in ihre Klasse kommt.
„Von allen Büchern Urys“, sagt Marianne Brentzel, „ist das das bedeutendste, weil vielschichtigste. Als einziges bebildert es nicht nur heile Welt. Als einziges ist es politisch, zum Beispiel darin, als wie selbstverständlich es den Umgang der Menschen mit dem Krieg schildert. Und als einziges stellt es dar, wie grausam Kinder Kinder zu mobben vermögen.“
Wie weise die verlegerische Setzung war, Cover, Bilder und Urys Text in historischer Faktur zu belassen und Brentzels Vorwort davon schrifttechnisch abzuheben, zeigt sich gerade hier, provoziert der Gegensatz doch ein verschärftes Nachdenken darüber, was an Band 4 „nur“ historisch erhellend sei und was quasi nahtlos auf unsere Gegenwart übertragbar. Wird hier Vergangenes bloß ausgestellt? Oder ist, mit Brecht, der Schoß, aus dem es kroch, fruchtbar noch?
Fortlaufend entrechtet
Eingebettet in die Familienerzählung ist die Geschichte des „Polenmädchens“ Vera, das, anfangs nur gemieden, unter Nesthäkchens Ägide als „Spionin“ dem Hass der Schulgemeinschaft ausgesetzt wird. Die, noch dazu für ein Kinderbuch, in dieser Drastik äußerst seltene Zeichnung von Ausgrenzungsmechanismen gelingt Ury so subtil und wahrhaftig, dass dem Leser Mal um Mal der Atem stockt.
Auch weil ihn spätestens jetzt das Aktuelle des Texts überfällt. Marianne Brentzel vermutet hinter diesem Handlungsstrang eigenes Erleben der Autorin: „Keiner kann das so wiedergeben, der es nicht am eigenen Leibe erfahren hätte“.
Das nämlich ist die Geschichte hinter der Geschichte von Nesthäkchen und dem Ersten Weltkrieg: Else Ury (1877–1943), Kind einer Fabrikantenfamilie, war Jüdin und wird als solche schon früh Ausgrenzung erfahren haben. Dennoch machen ihre Bücher sie zu einer hoch angesehenen Persönlichkeit in den Zwanzigern, die Auflagen erreichen Millionen bis in die Nazizeit hinein.
1935 aber wird sie aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen, fortan wie alle Juden fortlaufend entrechtet. Das Vorwort beschreibt Urys Vertrauen auf die Schutzfunktion der eigenen Berühmtheit wie die bewusste Entscheidung, sich mit den Leidensgenossen solidarisch zu verhalten. Am 12. Januar 1943 wird Ury in einer Gaskammer in Auschwitz-Birkenau ermordet.
Ihr Lieblingsneffe, der heute in London ansässige Klaus Heymann, dem sie, so lernen wir von Brentzel, nach eigenem Bekunden zeitlebens „wie eine zweite Mutter“ war, hat der Neuauflage zugestimmt.