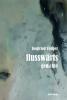Gedanken zu den im Entstehen begriffenen Gedichtband von Hellmund Wiese 'ungefähr zwischen dem morgen'
 Helmund Wiese und seine Lyrik zu besprechen, das ist wie ein Essay zum letzten Jahrhundert der Lyrik zu verfassen. „gebunden an einen pfahl / durchbohrt / von flammenden pfeilen / das bin ich“, so schreibt er selbst (über sich?). Auch wenn er das heroisch anmutende Bild in späteren Zeilen hinterfragt, wendet und vielleicht sogar an anderen Stellen verneint, so scheint es ein passendes zu sein. Hier ist jemand, der schreibt mit seiner ganzen poetischen Leidenschaft des Erfassens und Fühlens von Welt, gleichgültig, wie sehr er die Welt, die Literatur, das Denken für zerstört, fragmentiert, verlogen hält. Er kann nicht anders als in eine sprachliche Auseinandersetzung mit Welt zu gehen und ist dabei doch gewiss: „ideen sind wörter / grassierende seuchen / gravierende nichtigkeiten“.
Helmund Wiese und seine Lyrik zu besprechen, das ist wie ein Essay zum letzten Jahrhundert der Lyrik zu verfassen. „gebunden an einen pfahl / durchbohrt / von flammenden pfeilen / das bin ich“, so schreibt er selbst (über sich?). Auch wenn er das heroisch anmutende Bild in späteren Zeilen hinterfragt, wendet und vielleicht sogar an anderen Stellen verneint, so scheint es ein passendes zu sein. Hier ist jemand, der schreibt mit seiner ganzen poetischen Leidenschaft des Erfassens und Fühlens von Welt, gleichgültig, wie sehr er die Welt, die Literatur, das Denken für zerstört, fragmentiert, verlogen hält. Er kann nicht anders als in eine sprachliche Auseinandersetzung mit Welt zu gehen und ist dabei doch gewiss: „ideen sind wörter / grassierende seuchen / gravierende nichtigkeiten“.
Philosophisch, denkerisch, literarisch gibt Helmund Wiese die Idee einer erklärbaren Ganzheit von Welt auf. Ergebnis des Denkens und Fühlens eines promovierten Chemikers, der zudem in der Unternehmensplanung eines Konzerns tätig war?
Doch mag man an dieser Stelle einwenden, ist es nicht falsch, dem Autor zu unterstellen, er würde keine Welterklärungsmöglichkeit mehr sehen? Schließlich wendet er einheitliche formale Mittel an. So verfasst er sein gesamtes Werk in Kleinschreibung. Doch muss dies nicht als Erklärungsmuster, vielmehr als Beschreibungsmoment von Welt verstanden werden. Alles, aber auch wirklich alles ist gleichbedeutend in der Außenbeschreibung, jedes Ding, jeder Sachverhalt gleichwertig neben dem anderen. Die Wertung ist ein subjektiver Akt – „eine lyrische ich-ag“. Die radikale gesellschaftliche Individualität des Denkens und Fühlens schafft eine gleiche Bedeutung von Wichtigkeit und Unwichtigkeit, lässt auf den ersten Blick Unzusammengehörendes zusammengehören: „die rolltreppe im kaufhaus und / die kondome pflanzen sich fort / mit bananengeschmack dort / wo die nachgeburt vergraben wird“. Keine erkennbare Reimschema, kein durchgehend er¬kenn¬bares Versmaß – noch mehr Hinweise auf die Zerrissenheit der erkennbaren Welt. Fehlende Satzzeichen unterstreichen die Feststellung eines objektiv nicht setzbaren Anfangs und Endes. Die wuchtige, stark beladene Symbolik seiner Verse – scheinbar dahingeworfen. Sie verunsichert den Leser, der nicht weiß, wohin er sie entschlüsseln soll, denn er findet nicht das Vorgegebene, in das hinein er entschlüsseln kann, muss vielmehr die Entschlüsselung, die Auflösung der Bedeutung in sich selbst hinein vor¬nehmen, in seine Individualität. Er, der Lesende, ist der Sinngebende, der den Zusam¬menhang Herstellende, der Autor macht Vorgaben für eine mögliche Weltsicht, ohne Verbindlichkeit. „ungefähr zwischen den morgen“ gibt als Titel die Möglichkeit des Sinngebenden an, ohne sie präszisieren zu wollen.
Skurrile Fragmente einer Welt werden zu Gedichten zusammengestellt (mit einer un-glaub¬lichen Lust und einer Faszination am Klang- und Wortspiel), die den Leser gefangen nimmt, ihn herausfordert, ihm die Aufgabe des Zusammenfügens stellt.
Unendliche Assoziationsmöglichkeiten bieten sich dem Leser an, Worte, Teilsätze, ganze Verse oder Versgruppen zu erfassen. Doch der Autor lässt ihm beinahe keine Zeit. Schon drängt die nächste Asoziastionskette, hetzt, verschlingt.
Natürlich ist dies eine intellektuelle Lyrik, die den mündigen, verantwortlichen Leser verlangt, der bereit ist, sich auf das fragmentarische Wort und Klangspiel des Autors einzulassen, damit die Chance bekommt, die Welt mit anderen Augen wahrzunehmen: „jünger als ich / ein fanal / kündet von neuem und / von veränderung / eine indische witwe / mit benzin übergossen und angezündet / und über dein vorsorgekonto ziehen die wolken“.
Doch auch für den ungeübteren Leser gibt es Zusammenhänge zu entdecken, gibt es die Möglichkeit, neue Sinnlickeiten und Weltsichten zu entwickeln.
Alfred Büngen