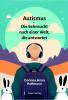Geht in die lektorale Arbeit: Heribert Rück - Der Bams
Heribert Rück
Der Bams
Die Geschichte von einem, der sich verweigerte
Er heißt Kurt Krumm, doch im Heim für Schwererziehbare nannten sie ihn Bams, weil er sich eines Sonntags darüber aufregte, dass alle die „Bild am Sonntag“ lasen. Er hat seinem früheren kleinkriminellen Leben abgeschworen und ist bestrebt, sich zu bilden. Seine wichtigste Lektüre ist DER HERR DER RINGE, mit dessen Phantasiewelt er sich identifiziert. Auch ein Buch über den Ursprung der Welt, das er im Bücherschrank fand, las er, wenngleich es nur unvollkommen verstehend, mit Interesse. Gegen seine Umgebung schottet er sich ab, auch dem Heimleiter verweigert er den Kontakt. Als dieser ihn vor die Tür setzt, vor allem auch, weil er das Höchstalter für das Heim weit überschritten hat, bringt ihn Markus, ein Zivildienstleistender, zu sich nach Hause. Hier erhält er ein Zimmer und das Angebot, am Familienleben teilzunehmen. Obwohl ihm dies widerstrebt, bemüht er sich zunächst, durch handwerkliche Hilfe Sympathien zu gewinnen. In dem ihm zugewiesenen Zimmer schafft er eine rigide Ordnung, die ihm hilft, in seiner halb-autistischen Welt zu bestehen.
Die Familie, bei der er nun wohnt, lebt in einer Art kreativer künstlerischer Unordnung. Der Hausherr, Gregor, ist Maler und erntet mit seinen abstrakten Bildern beachtliche Erfolge. Seine Frau Saskia ist Holländerin. Sie musiziert gern, gibt Flötenunterricht und kümmert sich um den (im übrigen naturwüchsigen) Garten. Es gibt fünf Kinder, vier davon erwachsen, der Jüngste Teenager. Eine Tochter studiert in England, eine andere leistet Entwicklungshilfe in Afrika, wo sie sich in einen Stammeshäuptling verliebt und allen Studienplänen absagt. Die damit einhergehenden Konflikte belasten die Familie. Zwar sind die Eltern keineswegs rassistisch gesinnt, doch man hatte für die hochbegabte Tochter eine andere Zukunftsperspektive.
Das Zusammenleben in der Familie ist getragen von Empathie. Das Gespräch, auch über religiöse Fragen, spielt eine wichtige Rolle. Man versucht, Kurt einzubeziehen, doch gelingt dies nur ansatzweise. Immerhin wird erkennbar, dass die Frage nach Gott auch Kurt beschäftigt. Er verneint die Existenz eines Schöpfergottes und beruft sich dabei auf die Wissenschaft, wie er sie versteht. Während Gregor in einer Art christlichem Urvertrauen verwurzelt ist, zweifelt Saskia an einer höheren Gerechtigkeit. In diesem Punkt versteht sie sich mit Kurt.
Über dieses Verstehen hinaus gibt es jedoch kaum eine wechselseitige Annäherung zwischen den beiden. Sie, die anfangs dafür war, ihn aufzunehmen, die ihn auch mag, sieht sich brüsk von ihm abgewiesen, ja sogar provoziert. Gregor erklärt dies durch Kurts bisheriges Leben in einer reinen Männerwelt. Offenbar hat der junge Mensch den Umgang mit Frauen nie gelernt. Dies betrifft auch Kurts Versuch, mit der Inhaberin eines Imbissstandes eine Beziehung anzuknüpfen. Das Weibliche ist für ihn eine Herausforderung. Er will sich beweisen, dass es ihm gelingt, eine Frau „anzumachen“, sie am Ende auch „flach zu legen“. Doch sein Sexualleben ist gestört. Er weiß um sein Potenzproblem und ahnt in sich etwas Dunkles, das er beherrschen muss.
Im weiteren Verlauf der Erzählung geht es um die Frage, ob bei Kurt eine Entwicklung hin zu mehr Menschlichkeit und vielleicht sogar Liebe möglich ist. Auch Gregors Angebot, in der Bibel zu lesen, steht im Raum. Wird er es annehmen? Wird es mit Franziska, der jungen Frau vom Imbiss, zu mehr kommen als zum bloßen körperlichen Kontakt? Am Schluss des Romans gewinnt der Aspekt der Liebe durch die Verletzung der Frau (sie wurde überfallen) an Bedeutung. Kurt entdeckt ein für ihn neues Gefühl. Franzikas Geständnis, dass sie ihn liebt, erschüttert ihn positiv. Er empfindet seine Hilfsbedürftigkeit und öffnet sich dem mütterlichen Angebot der Frau des Hauses, das er bisher abgelehnt hat. Zum ersten Mal nimmt er an einem gemeinsamen Essen teil. Als er aus dem Haus tritt, liegt vor ihm ein sonniger Tag.