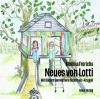Volker Issmer mit Vortrag zur Auswirkung des Attentats auf Hitler am 20. Juli in Osnabrück
Als Politiker in Ohrbeck hinter Gittern saßen
Nachdem das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 fehlgeschlagen war, beeilte sich der Sicherheitsapparat des Regimes, potenzielle Gegner auszuschalten, auch wenn sie nicht zu der Gruppe der Verschwörer gehört hatten. Besonders Mitglieder der SPD, der KPD, von Gewerkschaften und der katholisch geprägten Zentrumspartei standen auf den Listen, die auf Weisung eines Fernschreibens von Reichsinnenminister Heinrich Himmler, in dem von der „Aktion Gitter“ die Rede ist, zusammengestellt worden waren.
In der Region Osnabrück/Emsland wurden am frühen Morgen des 22. August 1944 53 Politiker der Arbeiterparteien und eine nicht bekannte Zahl von Zentrumsangehörigen verhaftet und in das Arbeitserziehungslager Ohrbeck interniert, wo sich heute die Gedenkstätte befindet. Ein von Volker Issmer vorgestelltes Geheimschreiben der Gestapo aus der Zeit danach spricht von einer Beunruhigung in der Bevölkerung darüber, dass sich die meisten der Verhafteten in vorgerücktem Alter befanden und es vielen unverständlich war, „wie diese alten Leute dem Staat eine Bedrohung sein könnten“. Die meisten von ihnen wurden nach wenigen Wochen Haft freigelassen, für andere führte der Weg aber weiter in ein Konzentrationslager, wo einige von ihnen ermordet wurden.
Issmer, Historiker und Buchautor, hat für seine Forschungen zum Widerstand in der Region die sogenannte Gestapo-Kartei im Niedersächsischen Staatsarchiv ausgewertet. Eine Verbindung der Genannten zu den Verschwörern habe es nicht gegeben, vielmehr hätten sich viele von ihnen mit Gedanken beschäftigt, die „auf eine Zeit nach dem Ende des Regimes“ gerichtet waren.
In seinem Vortrag ging er ebenfalls auf die Existenz der Edelweißpiraten ein, junger Menschen, die sich der Zugehörigkeit zu den NS-Jugendorganisationen verweigert hatten. In Osnabrück und Haselünne habe es Zellen gegeben, wenngleich von ihnen nur ein „harmloser Widerstand“ ausgegangen sei.
Eine weitere Gruppierung ist der „Kotten-Kreis“ gewesen, so genannt nach dem Treffpunkt in einem Kotten in Lienen-Holperdorp, wo es zu Zusammenkünften regimekritischer Kräfte kam, die aber von Anfang an der Gestapo bekannt gewesen ist. Zusätzlich sind eine Reihe von Widerstandshandlungen einzelner Personen vorhanden, wie etwa jene der Osnabrückerin Luise Lütkehoff, die einem Aufseher in den Arm gefallen war, als dieser einen Zwangsarbeiter misshandelte.